Mit der Energiestrategie 2050 hat die Schweiz den Weg eingeschlagen hin zu einer CO2-neutralen Energieversorgung. Die erforderliche Elektrifizierung der Mobilität und der Wärmeversorgung, aber auch die zunehmend dezentrale Energieproduktion und -speicherung, stellen neue Anforderungen an die Versorgungsinfrastruktur. Dadurch ändert sich nicht nur die Art und Weise, wie Verteilnetze betrieben werden – die Netze erleben derzeit ihren grössten Umbau seit der Gründung der ersten Elektrizitätswerke.
Der kosteneffiziente und stabile Betrieb des Verteilnetzes der Zukunft erfordert drei Elemente:
- Einen gezielten und vorausschauenden Netzausbau
- Ein aktives Management von Netzengpässen
- Ein aktives Management der Ausgleichsenergie, respektive verbesserte Prognosen
Noch manifestieren sich Netzengpässe oder hohe Kosten für Ausgleichsenergie nur punktuell. Der aktuelle Zubau von PV-Anlagen ist meist möglich, weil Netzinfrastrukturen in der Vergangenheit vorausschauend – aus damaliger Sicht könnte man auch sagen überdimensioniert – geplant wurden. Wir profitieren heute von Leistungsreserven in der vorhandenen Infrastruktur, die wir unseren Vorläufern zu verdanken haben. Diese Reserven werden nun schneller aufgebraucht, als der Netzausbau neue schaffen kann. Damit steigt die generelle Auslastung der Infrastruktur. Gleichzeitig verlieren die Netzbetreiber die Eingriffsmöglichkeit bei den lokalen Flexibilitäten aufgrund der neuen Gesetzeslage (Flex Opt-out).
Die Politik hat gerade erst wahrgenommen, wie wichtig ein bedarfsgerechter Netzausbau für die langfristige Versorgungssicherheit ist und welche Kosten dies mit sich bringt. Bis politische Lösungen vorliegen, werden zahlreiche Anlagen bereits am Netz sein. Somit obliegt es den Netzbetreibern, jetzt aktiv zu werden und die möglichen Probleme bereits frühzeitig zu adressieren.
Lösungsansätze sind vielfältig und noch hat sich kein Standard etabliert. Klar scheint: Netzausbau allein ist kein zielführender Ansatz. Es braucht die richtige Incentivierung der Stromkonsumentinnen und -konsumenten sowie die adäquate Messung und Regelung des Verteilnetzes. Unabhängig vom Lösungsansatz gilt es für Energieversorgungsunternehmen (EVU), folgende vier Ebenen zu beachten:
A) Ein aktives Management des Verteilnetzes ist nur möglich, wenn Infrastruktur und Flexibilitäten vom EVU erschlossen werden.
B) Ein zunehmend dezentral geprägtes Verteilnetz sollte in erster Linie dezentral optimiert werden.
C) Ein gutes Verständnis des aktuellen Zustands (z.B. vorhandene Engpässe oder Spannungsverletzungen) ist nötig.
D) Die Voraussetzungen für zentrale Regeleingriffe sollten geschaffen werden.

Im Folgenden werden die vier Ebenen A bis D vorgestellt. Für jede Ebene wird aufgezeigt, welche Fragen sich für ein EVU stellen, wenn es sein Verteilnetz auch zukünftig intelligent, kosteneffizient und stabil betreiben möchte. Dabei werden sowohl netz- als auch marktseitige Aspekte sowie regulatorische Rahmenbedingungen berücksichtigt.
A) Infrastruktur erschliessen
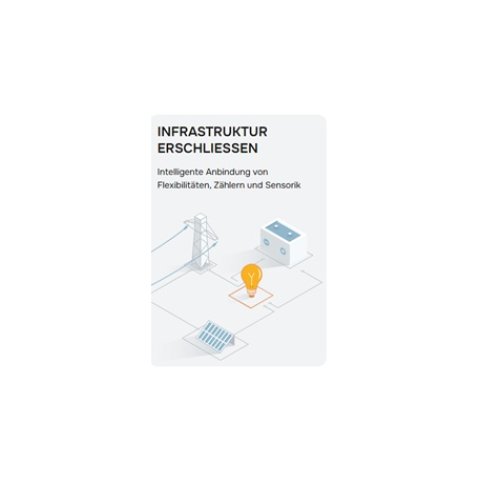
Bereits beim ersten Element wird es kontrovers. Zu welcher Infrastruktur muss oder will ich als EVU zukünftig einen Zugang haben? Muss ich mir einen Zugriff auf Ladestationen, PV-Anlagen oder Wärmepumpen sichern? Brauche ich Echtzeitdaten aus einer Trafostation, einer Verteilnetzkabine, von einem Smart Meter oder Spartenzähler?
Das Meinungsspektrum ist breit und aktuell gibt es keinen Konsens. Einige EVU stellen sich auf den Standpunkt, dass sie Endkunden zukünftig über eine intelligente Tarifierung so weit steuern, dass diese sich netzdienlich verhalten. Infrastruktur intelligent zu erschliessen, wird damit für das EVU überflüssig – der Endkunde managt sich selbst.
Wiederum andere EVU sehen ein grosses Potenzial in der intelligenten Erschliessung von Flexibilitäten. Dies zur Sicherstellung der Netzstabilität, der Optimierung von Ausgleichsenergie oder für die Erschliessung von neuen Geschäftsmodellen mit den Endkunden.
Sollten EVU nun Flexibilitäten erschliessen? Ein EVU sollte sich dies zumindest gut überlegen. Denn ohne Zugang zu den relevanten Flexibilitäten und ohne Transparenz bezüglich dem aktuellen Netzzustand wird es zukünftig schwierig, den stabilen Verteilnetzbetrieb bei angemessenen Kosten zu gewährleisten. Gerade im Ausland mit liberalisiertem Strommarkt etablieren sich dieser Tage diejenigen, welche in der Lage sind, den Endkunden und dessen Flexibilitäten eng einzubinden. Denn dies führt zu geringeren Kosten, einem besseren Service und Upselling-Potenzial. Weshalb sollte das in der Schweiz anders kommen?
Für Flexibilitäten wie Elektrofahrzeuge, PV oder Wärmepumpen gibt es aus Sicht eines EVU drei Arten von Flexibilitätserschliessung:
- Die Klassische: Flexibilitäten werden über ein Relais angebunden, entweder mit einem oder mit zwei Schaltkontakten. Relais haben den Vorteil der einfachen Anbindung von Flexibilitäten. Sie ermöglichen den Abwurf oder das Zuschalten einer Flexibilität, allenfalls auch mit einer gewissen Granularität im Falle von zwei Relais, welche vier Schaltniveaus ermöglichen. Das EVU kann damit die Netzstabilität sicherstellen, wenn der Zugriff auf die Relais gewährleistet ist. Bei Schlüsselflexibilitäten können performante Kommunikationstechnologien wie Glas, Mobile oder Breitband-PLC den Unterschied machen. Die fehlende Intelligenz der Schaltung ist kein Problem für ein EVU, welches primär die Netzstabilität als Ziel hat und dafür gewisse Komforteinbussen beim Endkunden und potenziell höhere Kosten in Kauf nimmt. So kann beispielsweise – insbesondere ohne lokale Intelligenz – nicht sichergestellt werden, dass der Eigenverbrauch beim Abwurf einer PV-Anlage berücksichtigt wird. Es kann entsprechend zu einem Abwurf kommen, obschon ein Grossteil der Strommenge im Eigenverbrauch konsumiert wird.
- Ist eine intelligentere Kommunikation mit Flexibilitäten erwünscht, gibt es die Verbindungsvariante «Zukunfts-Ready». EVU nutzen dabei eine der intelligenteren Schnittstellen ihrer Flexibilitäten (Beispiel Ethernet) und schöpfen das volle Potenzial auch im Hinblick auf die lokale Regelung (Ebene B) aus. Dies ist weiterhin eine physische Verbindung zwischen dem lokalen Gateway/Rundsteuerung/Smart Meter und der Flexibilität. EVU sichern sich bereits heute diesen Zugang über entsprechende Werksvorschriften, welche es ihnen zukünftig ermöglichen, das volle Potenzial der Flexibilitäten auszunutzen. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass sich EVU die digitale Stromschnittstelle im Privathaushalt sichern. Der Smart Meter Rollout ist dafür eine einmalige Chance, welche es zu nutzen gilt, um ein EVU auch langfristig und in einem potenziell teilliberalisierten Markt gut zu etablieren. Verschiedene Technologien existieren und EVU arbeiten bereits heute an dieser Umsetzung.
- Die dritte Variante der Flexibilitätserschliessung ist die wohl einfachste, aber im Hinblick auf die Versorgungssicherheit unsicherste. Viele neue Flexibilitäten wie Elektrofahrzeuge oder Wechselrichter sind bereits ans Internet angeschlossen. Die Schnittstellen können dem EVU vom Endkunden zur Verfügung gestellt werden. Dadurch, dass die Verbindung meist über ein lokales Wifi oder Mobilfunk hergestellt wird und der Endkunde jederzeit den Zugang kappen kann, ist diese Art von Erschliessung mit gewissen Risiken verbunden. Nichtsdestotrotz zeigen verschiedenste Beispiele aus dem Ausland (aber auch Inland – Beispiel Smart Charing App CKW), dass diese Art von Anbindung durchaus für die Netzstabilisierung genutzt werden kann. Der duale Ansatz der Flexibilitätserschliessung könnte sich etablieren – einerseits die physische Anbindung beim Endkunden und andererseits die Option, Flexibilitäten auch direkt übers Internet zu erschliessen.
In diesem Abschnitt nicht thematisiert wurde die Echtzeitvermessung von Trafostationen, Verteilnetzkabinen und Power Quality von Smart Meter. Es scheint ausser Frage, dass das Verteilnetz zukünftig in Echtzeit überwacht werden muss. Die Granularität dieser Überwachung wird stark vom Verteilnetz des EVU abhängig sein.
Schlüsselfrage für EVU: Was für einen Stellenwert haben Flexibilitäten bei Ihnen?
- Finger davon lass: Damit haben wir nichts zu tun.
- Eine Notwendigkeit für die Energiewende, aber primär eine Herausforderung: Im Notfall brauchen wir einen Durchgriff.
- Eine grosse Chance: Wir wollen eine aktive Rolle spielen.
B) Lokal regeln

Home Energy Management Systems, sogenannte HEMS, sind gute Beispiele für das lokale Regeln. Mit der Unterstützung eines HEMS kann eine Stromkonsumentin bzw. ein Stromkonsument das Eigenheim energetisch optimieren. So wird der Ladezyklus eines Elektroautos auf die Stunden am Tag gelegt, an welchen die PV-Anlage Strom produziert. Oder in der Nacht wird Strom von einer lokalen Batterie bezogen.
Die Voraussetzung für eine lokale Optimierung ist lokale Rechenpower in Form eines Gateways oder HEMS, welche das dezentrale Flexibilitätsmanagement ermöglicht. Bereits kleine lokale Eingriffe können Wirkung zeigen. Im Falle eines Leistungstarifes übernimmt beispielsweise die lokale Intelligenz die Überwachung. Bei einer Verletzung der Grenzen wird direkt eine Warnung an die App des Endkunden gesendet. Dieser erhält damit die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Oder die lokale Intelligenz koordiniert lokale Flexibilitäten einem tagesaktuellen dynamischen Tarif entsprechend. Boiler werden beispielsweise zum günstigsten Zeitpunkt aufgeheizt.
Lokales Regeln mittels lokaler Intelligenz wird ein zentrales Element im Verteilnetzmanagement. Der Verteilnetzbetreiber könnte sich dabei auf den Standpunkt stellen, dass Endkunden mit grösseren Flexibilitäten unabhängig vom EVU-Angebot eine HEMS-Lösung implementieren. Das stimmt – das EVU sollte dabei aber beachten, dass eine Optimierung durch Dritte nicht zwingend mit den Interessen des EVU übereinstimmt. Bei Elektroautos wird es zusehends zum Standard, dass der Autohersteller auch die Möglichkeit von Smart Charging anbietet – einer einfachen Form der lokalen Optimierung. Dabei liegt das Augenmerk der Autohersteller auf der Nutzung der Batterien für ein attraktives Geschäft am Regelenergiemarkt. Dass dieses nicht zwingend mit den lokalen Gegebenheiten im Verteilnetz übereinstimmen muss, ist dabei offensichtlich. Wie stellt das EVU die Netzstabilität sicher, wenn plötzlich Dritte grosse Flexibilitäten dynamisch im Verteilnetz ansteuern? Ist nicht das EVU der prädestinierte Akteur als Flexibilitätsmanager im Verteilnetz? Das EVU ist in der einzigartigen Ausgangslage, sowohl die Netztopologie, den aktuellen Netzzustand als auch die vorhandenen Flexibilitäten zu kennen und diese gezielt zu managen. EVU, welche bereits heute die Voraussetzungen für lokales Regeln mittels lokaler Intelligenz (Edge Intelligenz) schaffen, könnten sich damit nachhaltig einen Vorteil verschaffen.
Nicht weiter vertieft wurden hier die lokalen Datenanalysen dank lokaler Intelligenz, welche sowohl für das EVU als auch für den Endkunden spannend sein können. Dank lokaler Intelligenz wäre ein EVU in der Lage, lokal zu detektieren, ob eine Wärmepumpe oder eine PV-Anlage korrekt funktioniert.
C) Netz visualisieren

Die Netzvisualisierung macht den Schritt vom Endkunden zum EVU und zur zentralen Regelung des Verteilnetzes. Sowohl bei der Netzvisualisierung (Ebene C) als auch bei der zentralen Regelung (Ebene D) ist zwischen Ansätzen mit oder ohne digitalem Verteilnetzzwilling zu unterscheiden. Diese Unterscheidung ist essenziell, da die Ansätze von einer sehr unterschiedlichen Ausgangslage ausgehen. Ein digitaler Zwilling liegt dann vor, wenn das EVU in der Lage ist, das Netz in seiner Gesamtheit digital zu simulieren (Details der Trafos, verlegte Kabel etc. sind bekannt), um Engpässe zu identifizieren, verschiedene Szenarien des Netzausbaus abzubilden, das Netz zu überwachen und allenfalls auch automatisch zu regeln und damit zu optimieren. Die Herausforderungen des digitalen Zwillings sind für viele EVU die Datenqualität und -verfügbarkeit. Um diese zu verbessern, müssen teilweise Jahre investiert werden, was diese Projekte umfangreich machen kann. Nichtsdestotrotz ist davon auszugehen, dass ein EVU mittelfristig einen digitalen Zwilling hat oder dieser von jemandem für das EVU unterhalten wird.
- Die Netzvisualisierung ohne digitalen Zwilling kann ein relativ einfacher erster Schritt sein, um das Verteilnetz besser zu verstehen. Einfache Visualisierungen der Lastgangdaten im 15-Minuten-Takt können Lastflüsse ohne vollumfänglichen Zwilling in Echtzeit transparent machen. Weiter können PQ-Daten von den Smart Meter zusätzliche Informationen liefern. Das Verständnis der Spannungsqualität im Verteilnetz ist damit der erste und wichtigste Schritt für die Bewertung des Netzzustandes. Noch wird nichts automatisch geregelt, sondern es wird Transparenz geschaffen.
- Bei der Netzvisualisierung mit digitalem Zwilling wird eine vollumfängliche Visualisierung möglich. Engpässe auf einem Strang können dargestellt, Netzausbauszenarien können simuliert oder Netzprognosen erstellt werden. Für viele Elemente des zukünftigen Verteilnetzmanagements wird der digitale Zwilling essenziell sein. EVU sind gut bedient, wenn sie sich bereits heute damit auseinandersetzen. Das Fundament für jeden digitalen Zwilling ist eine saubere Datenbasis und -architektur. Dieses Fundament gilt es auf jeden Fall zu schaffen – unabhängig von der Wahl der zukünftigen Verteilnetzmanagement-Software. Es ist entsprechend zielführend, diese Datenbasis generell und systemunabhängig zu halten.
Viele EVU haben sich bereits auf den Weg gemacht, die Netzanalyse und die Anschlussgesuche in einem Zwilling zu digitalisieren. Dies ist ein guter und wichtiger erster Schritt. Bei der Auswahl der Lösung dazu gilt es sicherzustellen, dass auch zukünftige Bedürfnisse mit der Lösung abgebildet werden, denn der Integrationsaufwand von neuen Lösungen ist nicht zu unterschätzen. Essenziell ist dabei, dass die Lösung mittelfristig eine Echtzeitfähigkeit hat (mindestes 15-Minunten-Werte), damit das Verteilnetz aktiv gemanagt werden kann. Statischere Lösungen sind wohl in der Lage, Engpässe retrospektiv zu identifizieren oder Prognosen zu erstellen – wenn ein EVU aber auf eine aktuelle Gegebenheit reagieren möchte, kommen diese Lösungen an den Anschlag.
D) Netz zentral regeln
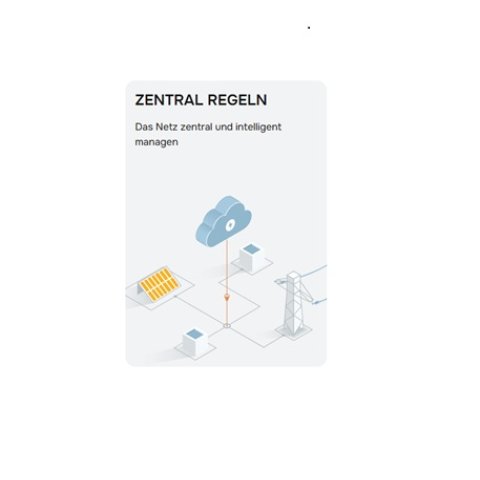
Im Abschnitt B wurde aufgezeigt, wie lokale Intelligenz bereits einen Beitrag zur Optimierung des Verteilnetzes leisten kann. Dabei handelt es sich um einen Ansatz im Sinne der heutigen Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV), welche versuchen, lokal produzierte Energie möglichst lokal zu nutzen. Es ist allerdings nicht von der Hand zu weisen, dass eine lokale Optimierung allein in vielen Fällen zu kurz greifen wird. Was auf der Höchstspannungsebene schon lange etabliert ist – ein aktives Management – wird sich zusehends auch auf der Netzebene 7 durchsetzen. Wie schon bei der Netzvisualisierung unter Punkt C muss zwischen einem Ansatz mit einem digitalen Netzzwilling und einem Ansatz ohne diesen unterschieden werden.
Zentrale Regelung ohne digitalen Netzzwilling: Ein spannendes Thema, welches in den letzten Monaten viel Aufwind erhalten hat, ist die Optimierung der Ausgleichsenergie. Die Kosten für Ausgleichsenergie sind in den letzten Jahren drastisch gestiegen und auch kleinere Verteilnetzbetreiber finden sich zusehends in einer Situation, in welcher Ausgleichsenergie zum Thema wird. Vollversorgungsaufträge werden gekündigt oder werden signifikant teurer, da die Vorhersagen der Solarproduktion schwieriger werden und negative Strompreise sich häufen. Mit den ambitiösen PV-Zubauplänen im Rahmen des neuen Energiegesetzes wird sich diese Situation weiter verschärfen. Ausgleichsenergie wird entsprechend zu einem akuten Kostentreiber, den es zu managen gilt.
Die zentrale Regelung von Flexibilitäten kann dabei einen Beitrag leisten, um die Kosten zu reduzieren. Die Basis für das EVU bildet der Echtzeitvergleich zwischen prognostizierter Leistung im Netz und effektiver Leistung. Ist diese Differenz bekannt, kann ein EVU einerseits eigene Produktionsleistung für einen Ausgleich und die Netzstabilität einsetzen – was heute vielerorts bereits gemacht wird. Andererseits kann ein EVU zukünftig auch die Flexibilitäten der Endkunden dazu nutzen. Bei teilweise extremen Preisen von >1CHF/kWh für Energie am Spotmarkt können bereits kleine Flexibilitäten einen grossen Kostenbeitrag erbringen. Um vom grossen Potenzial im eigenen Verteilnetz zu profitieren, muss sich das EVU den Zugang zu den relevanten Flexibilitäten sichern – dies in Echtzeit. Weiter ist es wichtig, eine Vorstellung bezüglich der vorhandenen Flexibilität im System zu haben, um den Einfluss eines Eingriffes vorherzusagen.
Ein zweites Beispiel von zentraler Regelung ist das aktive Management von Netzengpässen, basierend auf einer Referenzmessung. Bereits vielerorts in Umsetzung ist die Ansteuerung von Flexibilitäten in einem Trafokreis, basierend auf einer Leistungsgrenze beim Trafo. Sobald ein Schwellenwert in der Trafostation überschritten wird, werden zugehörige Flexibilitäten abgeworfen, um die Grenze nicht zu überschreiten. Dieser Ansatz ermöglicht es EVU, welche Engpässe bereits kennen, auch ohne digitalen Zwilling eine Echtzeitregelung zu implementieren.
Die zentrale Regelung basierend auf einem digitalen Netzzwilling dürfte sich zukünftig stärker verbreiten. In der Endausbaustufe führt dies zu einer vollautomatischen und vollumfänglichen Steuerung des Verteilnetzes zu dessen bestmöglicher Auslastung. Das ist aber noch lange kein Schweizer Standard. Vielmehr gibt es erste EVU, welche sich diesem Thema annähern. Spannend ist dies insbesondere für Verteilnetzbetreiber mit einem stark vermaschten Netz, in welchem Engpässe dynamisch auftreten und schwierig zu identifizieren sind. Mit einer Zunahme der Engpässe im Verteilnetz wird der Ansatz aber zusehends an Popularität gewinnen, da das EVU nicht mehr in der Lage sein wird, Engpässe individuell zu managen. Da das Verteilnetzmanagement in Echtzeit – basierend auf einem digitalen Zwilling – durchaus das Potenzial hat, sich in der Breite durchzusetzen, macht es für ein EVU bereits heute Sinn, auf eine Software-Technologie zu setzen, welche im Fundament ein digitaler Echtzeitzwilling ist. Für viele EVU ist es jedoch noch ein weiter Weg bis zum aktiven Echtzeitmanagement des Verteilnetzes. Der erste Schritt ist eine Analyse des eigenen Verteilnetzes, danach folgen viele Zwischenschritte.
Fazit
Um auch zukünftig den stabilen und kosteneffizienten Betrieb des Verteilnetzes zu gewährleisten, müssen sich EVU bereits heute mit den Herausforderungen der Elektrifizierung und Dezentralisierung befassen. Ein intelligenter Verteilnetzbetrieb erfordert Massnahmen auf vier Ebenen: Infrastruktur erschliessen, lokal regeln, Netz visualisieren und zentral regeln.
Über EVUlution
EVUlution ist ein Anbieter von EVU-Lösungen für das intelligentere Verteilnetzmanagement. SMARTPOWER, die Echtzeit Smart Metering Lösung mit Flexibilitätsmanagement schafft dabei die einzigartigen Voraussetzungen für die intelligente Erschliessung von Flexibilitäten und das lokale Regeln (Ebenen A und B). Die direkte Anbindung von Endkunden über das Kundenportal ENERGYBOARD stellt zusätzlich sicher, dass Stromkonsumentinnen und -konsumenten ein Teil der Lösung werden. Live Smart Meter Daten, intelligente Echtzeit-Datenanalysen und der direkte Zugriff auf Flexibilitäten machen das Portal besonders spannend für Stromkonsumentinnen und -konsumenten. Auf den Ebenen C und D bietet EVUlution Lösungen in beiden Bereichen: mit und ohne digitalen Zwilling. Mit GRIDCONTROL bietet EVUlution EVU den Zugang zu einer mächtigen Echtzeit-Verteilnetzmanagement-Software basierend auf einem digitalen Zwilling. Automatische Anschlussgesuche, Echtzeit-Monitoring, Prognosen und automatische Schaltbefehle werden damit möglich. Einfachere Anwendungen ohne digitalen Zwilling werden im Rahmen des Produktes SMARTFLEX stetig weiterentwickelt.










